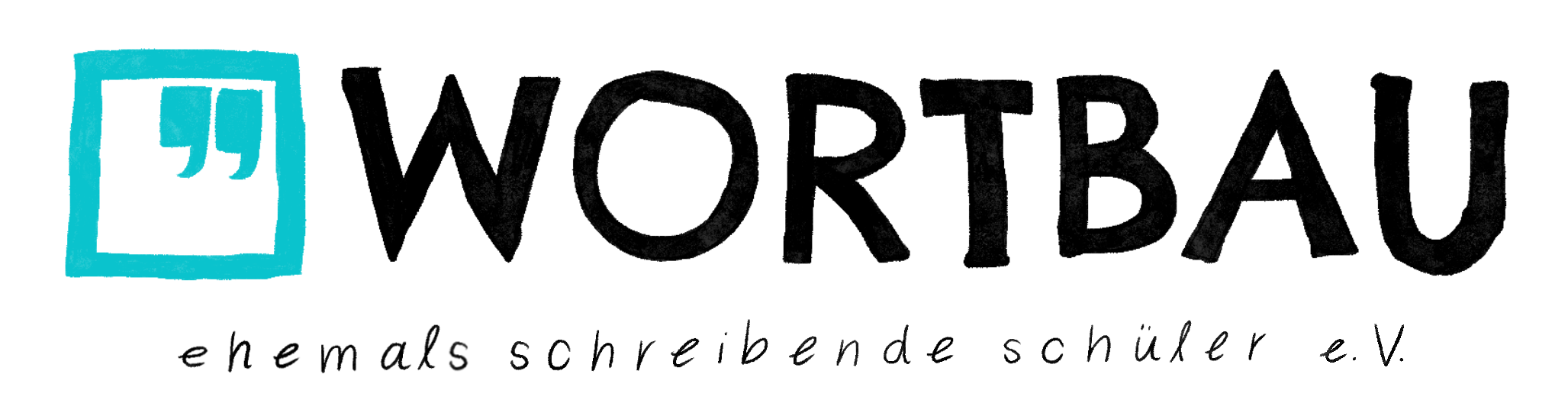Texte 2018
Die Geschichte von Ping
Alice Glusgold (8 Jahre), Berlin – Junior-THEO
Es war einmal eine ganz kleine Frau. Die war so klein, wie euer kleiner, kleiner Finger. Sie lebte ganz zufrieden und ganz allein in einer Mandarine. Natürlich mit Möbeln und alles war nur aus Mandarinen. Und einmal kam ein Mann mit dem Namen Astor. Er holte die Mandarine von seinem Obstteller und machte sie auf. Da sah er Ping. Er dachte, er würde einen Herzinfarkt kriegen. Doch nach fünf Minuten fasste er sich wieder und fragte: „Woher kommst du und wie heißt du?“ „Ich komme aus der Mandarine und heiße Ping und du?“ „Astor.“ „Du kannst mir doch bestimmt helfen, meinen Mann zu finden, oder?“ „Ja, klar.“ „Na, dann los!“, sagte Ping, und am nächsten Tag gingen sie los. Sie fuhren mit dem Schiff nach Marokko. Dann waren sie am Hafen und wollten sich ein Kamel mieten. Mit dem Kamel ritten sie durch die Wüste. Auf dem Weg kamen sie an ganz vielen Mandarinenbäumen vorbei und sie hatten von zu Hause ganz viele Säcke mitgenommen und stopften die Säcke voll mit Mandarinen. Dann wurden sie von Räubern überfallen, die ihnen die ganzen Säcke wegnahmen, weil sie dachten, da wäre viel Gold drin. Da mussten Astor und Ping schnell wegreiten und das Kamel war so schnell, dass Ping nur noch am Schwanz hing. Da nieste das Kamel und Ping fiel in den Sand. Astor merkte es nicht und ritt einfach weiter. Nach einer Weile merkte Astor, dass Ping fehlte. Dann ritt er schnell wieder zurück. Er musste lange suchen, bis er sie fand und als er sie fand, war es schon Abend geworden. Zum Glück hatten sie Isomatten und Schlafsäcke dabei. Ping hatte auch zwei Zahnbürsten. Sie fragte Astor, ob er eine haben wollte, aber weil sie für Astor zu klein war, sagte er: „Nein, danke“ Am nächsten Morgen wachten sie ganz froh von der lieben Sonne auf. Dann ritten sie weiter in eine Stadt mit sehr vielen Mandarinen auf dem Markt. Sie kauften sehr, sehr viele Mandarinen, um zu gucken, ob ihr Mann drin ist. Dann mieteten sie sich eine Pension mit einem Innenhof, mit einem Pool und ganz vielen Blumen. Gleich als sie angekommen waren, schwamm Astor im Pool und Ping tauchte mit den Beinen ins Wasser, weil sie Angst hatte, in dem Riesenpool zu schwimmen. Nach dem Schwimmen gingen sie wieder in das Haus und machten alle Mandarinen auf, aber so doll sie auch suchten, den Mann fanden sie nicht. Astor fragte Ping: „Wie sieht dein Mann eigentlich aus?“ Ping zog ein sehr gelbes und zerknittertes Bild aus der Tasche, das sie schon immer bei sich hatte und zeigte es Astor. Da erschrak er sehr. Dann sah auch Ping auf das Foto und sie erschrak auch sehr. „Das bist ja du!“, schrie sie. „Du bist mein Mann!“ „Ja.“, sagte Astor. Da fragte Ping Astor: „Wieso bist du so groß geworden?“ Astor sagte: „Das erzähle ich dir in einer anderen Geschichte.“
Träume
Junes Rattay (12 Jahre), Glienicke/Nordbahn – Prosa (10-12)
Wir schreiben das Jahr 1962. Es ist noch kalt in der Stadt, obwohl es schon Ende März ist. Frau Kleemann wohnt mit ihren Kindern Hans und Erika am Rande der ostdeutschen Hauptstadt in Rosenthal. Ihr Mann, der in Westberlin arbeitet und beim Mauerbau dort geblieben ist, hofft, seine Familie auch in den Westen holen zu können. Bisher hat das aber leider nicht geklappt.
Seit nunmehr zwei Monaten sind es in der Stadt Minusgrade. Es ist Montagmorgen. Hans muss aufstehen. Erika schläft noch. Sie geht noch nicht zur Schule. Hans weckt die Mutter und wäscht sich. Er kann sich nicht richtig waschen; die Wasserleitung ist eingefroren. Er muss sich mit einem Lappen trocken waschen. Seife haben sie auch keine mehr. Es gibt einfach nichts zu kaufen. Es ist dreiviertel sieben. Er muss los. Einfach den Feldweg entlang bis zur Hauptstraße und dann rechts. Er ist zu früh dran. Sein Freund Günther ist noch nicht da. Daher geht er alleine zur Schule. In der Schule ist Hans gar nicht mehr bei der Sache.
Bisher hat der Vater ihm regelmäßig Briefe geschrieben. Aber seit einem halben Monat hat Hans keinen Brief von seinem Vater bekommen. Wird er seinen Vater jemals wiedersehen? Nach der Schule will er noch nicht nach Hause. Er geht lieber nochmal an der Mauer vorbei. Er hat oft geträumt, wie es wäre, endlich wieder seinen Vater sehen zu können. Vielleicht steht der Vater auf der anderen Seite der Mauer und denkt das Gleiche. In den Gedanken versunken, schlendert er an der Mauer entlang. Es sind nur wenige Meter, die sie voneinander trennen – ein kleiner Zwischenraum.
Gegen drei Uhr kommt Hans zu Hause an. Er ist eine Stunde später dran als sonst. Seine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht. Er fragt, ob Post von dem Vater angekommen sei, obwohl er die Antwort schon kennt: „Nein, aber er schreibt uns bestimmt demnächst“, sagt die Mutter jedes Mal. Hans glaubt schon fast nicht mehr dran, aber trotzdem hofft er es. In der Nacht träumt Hans, dass er einfach über die Mauer springt und auf der anderen Seite der Vater steht und ihn auffängt. Könnte er nicht irgendwie zu seinem Vater gelangen? Die Grenzposten austricksen? Er möchte zu seinem Vater. Egal wie. Anfangs denkt er, er könnte die Mutter fragen, aber diesen Gedanken vergisst er schnell wieder. Nein, er muss es alleine durchziehen.
Es ist Dienstag. Heute steht er früher auf. Er zieht sich sofort an, weckt die Mutter nicht und geht eine halbe Stunde früher los. Er geht nicht auf direktem Weg zur Schule. Er geht quer durch Berlin-Rosenthal und sieht endlich die Mauer. Er überlegt. Wo könnte man am besten die Mauer überwinden? Da! Die Mauer macht einen Knick. Würde er sich im Dunklen hinter dem Busch verstecken, könnte man ihn von keiner Seite sehen. Links und hinten der Busch, rechts und vorne die Mauer. Er bräuchte ein Messer. Ein scharfes Messer. Er müsste Stufen in die Wand ritzen und an ihnen schnell hochklettern. Oben könnte er mit dem Messer den Draht durchtrennen. In den Gedanken versunken, vergisst er die Zeit komplett. Als er aus seinem Traum aufwacht, ist es schon zehn nach sieben. Er hat nur noch fünf Minuten Zeit. Hans rennt durch die Straßen und weiß, dass er heute das erste Mal zu spät in die Schule kommen wird.
Günther ist schon im Klassenraum, das weiß er, sonst würde er noch draußen auf ihn warten. Hans steht vor dem Klassenraum und weiß nun, dass der Unterricht schon begonnen hat. Sie haben heute bei Herrn Graten, einem der schlimmsten Lehrer der Schule. Es ist sechzehn nach sieben. Soll er einfach nach Hause gehen und sich krankmelden? Aber wie soll er das seiner Mutter erklären? Er gibt sich einen Ruck und klopft. Es bleibt ruhig im Klassenraum. Kein Geschimpfe, kein Gelächter, nichts. Hans klopft noch mal. Frau Seelow öffnet die Tür. Hans stutzt. Frau Seelow bemerkt Hans‘ verdutzten Blick und erklärt ihm, dass Herr Graten krank sei. Frau Seelow ist Hans‘ Lieblingslehrerin. Hans entschuldigt sich, setzt sich an seinen Platz und schaut zu Günther. Günther weiß sofort, warum Hans zu ihm guckt. Er sagt ihm die Aufgaben, damit Hans nicht Frau Seelow fragen muss. Hans öffnet das Buch, schweift in Gedanken aber wieder zu einem ganz anderen Thema ab: seinem Vater. „Hans“, ruft Frau Seelow. Hans fährt hoch. „Wie war die Frage?“, fährt es Hans durch den Kopf. Schnell flüstert Günther ihm die Frage zu, sodass er sie noch beantworten kann.
Hans wartet vor der Schule auf Günther. Sie haben einen ähnlichen Weg. Sie schlendern durch die Straßen und Hans bedankt sich bei Günther für seine Hilfe. Günther fragt, was los sei, und zeitweise überlegt Hans, ob er ihm sein Vorhaben verraten sollte, tut es aber nicht.
Eigentlich ist alles wie immer, Hans und Günther trennen sich an der Hauptstraße Ecke Feldweg. Hans geht den Feldweg entlang und Günther bleibt auf der Hauptstraße. Als er zu Hause ist, merkt er aber, dass etwas anders ist. Die Gartenpforte ist auf, der Briefkasten ist auf, die Tür steht sperrangelweit auf. Und in der Tür steht winkend die Mutter. Mit der einen Hand winkt sie, in der anderen hat sie einen Brief. Hans kommt auf die Mutter zu gerannt, als wüsste er, was die Mutter für einen Brief in der Hand hat. Hans reißt der Mutter den Brief aus der Hand und liest:
„Hallo Anne! Hallo Hans! Hallo Erika!
Entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich hoffe es geht euch gut. Ich habe alles versucht, euch in den Westen zu holen, aber leider hat es nicht geklappt. Ich werde in den nächsten Tagen zu euch zurückkommen. Bis bald!
Liebe Grüße von eurem Vater Uwe!“
Dass alle Menschen darin verschwinden
Tristan Ludwig (17 Jahre), Mannheim – Prosa (16-18)
„Wenn die ganze Welt in Flammen steht, ist es Gott wenigstens nicht kalt.“
Ich glaube nicht an Gott. Auch nicht an die Welt. Höchstens vielleicht an die Flammen, so genau weiß ich das doch selber alles nicht. Trotzdem sage ich gerade diesen Satz, weil er irgendwie in die Situation passt, es geht ja sowieso mehr um das Gefühl dahinter als um die Worte davor. Meine Gedanken ekeln mich an, schon wieder verlieren sie sich in Kaskaden von Rechtfertigungen vor mir selbst. Ich muss mich nicht rechtfertigen, nicht vor einem Menschen und schon gar nicht vor meinem Gewissen. Ich trinke Hustensaft, obwohl ich nicht erkältet bin, und trage nur noch Gucci.
Es ist recht kühl auf der Parkbank, dass mag ich. Wärme ist mir zuwider, sie ist etwas was Menschen ausstrahlen, Normaltemperatur zwischen 36 und 37 Grad Celsius, das muss man sich einmal überlegen: Das ist heißer als ein sehr heißer Sommertag, wenigstens hier, in meiner Mittelstadt in der Mitte von Baden-Württemberg, ein Mensch, der heißer ist als ein Sommertag, der schon so heiß ist, dass man lieber drinnen bleibt und die Klimaanlage anschaltet, das ist doch wirklich abnormal, unglaublich ekelerregend. Neben mir sitzt Gudrun, sie trägt einen Supreme-Sweater, und Andreas, er hat einen Pulli von Stone Island an. Natürlich sind das nur Decknamen. Ich bin Holger, weil ich mich geweigert habe, Ulrike zu sein, ich bin ja ein Junge – eigentlich schon ein Mann, es fällt mir nur immer noch schwer, dass so zu formulieren – und außerdem gefällt mir das, „Der Kampf geht weiter“, als ob es je irgendeinen Kampf gegeben hätte, dessen Bedeutung mehr gewesen wäre, als Spaß daran zu haben, dass es Bumm macht und dass das Blut so lustig spritzt aus der angestochenen Bauchdecke, oder irgendein Ideal, das zu etwas anderem gut wäre als Vorlage zu sein für metaironische Memepages. Die Nacht ist vielleicht schön, aber sinnlos, weil am Ende die Sonne aufgeht.
„Wir brauchen jetzt auch mal ein Ergebnis, einen konkreten Plan für eine Aktion“, Andreas Gesicht scheint fast ein wenig von innen heraus zu leuchten unter der stromsparenden und ultrahellen LED-Straßenlampe, durch die die Stadtverwaltung seit einiger Zeit die alten, gelblich-flackernden Laternen ersetzt, „das ist ja alles ganz nett, die Sachen, die wir hier so reden, aber am Ende wollen wir Terroristen sein, und dann müssen wir auch mal Terror machen.“ Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie wir, wenn es wirklich um etwas geht, in die Sprache zurückfallen, die schon vor uns da war, wie auf einmal alles Neue verschwindet, und wir die gleichen Gespräche führen, die schon vor vierzig Jahren in den konspirativen Wohnungen der verschimmelten BRD geführt worden sind. Ich werde wirklich wütend davon, wie sich alles im Kreis dreht, wie ein anderes Leben gar nicht möglich ist, als das, das uns von uns selbst vorgelebt wird. Für einen kurzen Moment will ich aufspringen und mit den Armen fuchteln und schreien, aber auch das haben schon so viele vor mir gemacht, darum zucke ich nur leicht mit den Schultern und lächle ein bisschen, ich fühle mich dabei wirklich dümmlich. Es ist so ermüdend, dass meine Gedanken nur in mir sind und nicht in all den anderen.
Wir sind also Terroristen. Nicht so wie irgendwelche Nazis oder Islamisten, auch nicht wie die RAF, obwohl die schon Style hatte, daher die Sache mit den Decknamen, aber ideologisch gibt es keine Verbindungen. Unser einziges Ideal ist der Terror, der reine Schrecken, wir sind da zumindest ehrlich. Wir machen das auch alles nicht – beziehungsweise wollen es machen, so richtig angefangen mit dem Terror haben wir ja noch gar nicht – weil wir Spaß haben an Mord und Gewalt, wenigstens nicht mehr, als es ein ganz normaler Mensch hat.
Gudrun zündet sich jetzt eine Zigarette an, sie nimmt ein paar Züge, dann drückt sie sie an ihrem Handrücken aus und lacht. Selbstverletzung ist für uns auch bloß ein Statement. „Wir müssen die Zwischenräume treffen“, ich sprechen nur, weil es in meiner Sozialisation begründet liegt, ein Gespräch am Laufen zu halten. Es ist beängstigend sich zu überlegen, wie viel Prozent der Dinge, die ich im Laufe meines Lebens gesagt habe, einzig gesagt worden sind, weil die Stille so unerträglich ist. Die anderen sehen mich verständnislos an, ich werde das wohl erklären müssen, ich hätte schweigen sollen. „Warum machen wir das den eigentlich?“, es ist immer besser, den anderen die Initiative zu überlassen, bei aller Kompromisslosigkeit des eigenen Lebensentwurfes braucht man doch immer eine Lücke, durch die man davonschlüpfen kann. Mit „man“ meine ich natürlich mich, und ein weiteres Mal verabscheue ich meine Gedanken.
Ein Windstoß weht das Laub, das tagsüber von den Parkangestellten an den Seiten des Weges aufgetürmt worden war, freundlicherweise zurück auf diesen, sodass ihr Anstellungsverhältnis weiterhin gesichert bleiben wird. Gudrun und Andreas wissen offensichtlich nicht, was sie antworten sollen. Je länger man ihre Gesichter betrachtet, desto hässlicher werden sie, unter der oberflächlichen Schicht von Instagram-Schönheit liegt das Ergebnis von Selbstzweifeln, Drogenmissbrauch und Internetkonsum verborgen, das sich besonders in solchen Momenten Bahn bricht und die Mienen zu grauen Masken erstarren lässt. Jegliche Selbstironie hat sich verflüchtigt, es lässt mich beinahe glauben, wir sind nur Freunde, weil wir zusammen so wenig Spaß haben können. „Das ist halt einfach nice“, Andreas sagt nun also doch etwas, seine Stimme ist dabei viel zu fest, sodass sie schon nicht mehr entspannt und selbstbewusst wirkt, sondern eher verkrampf, leicht unsicher sogar, „Wenn dann bei Spiegel Online die Berichte kommen über die Mittelstandskinder, die Lean trinken und Leute in die Luft sprengen, und dann da unsere Bilder sind und sie unsere Nachbarn im Hausflur interviewen und die dann sagen, dass wir immer nett gegrüßt haben und nur manchmal die Musik zu laut war und unsere Klamotten auch seltsam, na ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was das dann ist, irgendwie halt gut. Vielleicht sind wir dann tot, aber das ist eigentlich egal, weil wir werden dann ein Meme sein.“ Ich antworte ihm bloß mit einem „Genau“, er hat gar nichts verstanden, letztendlich ist das egal. Gudrun beginnt etwas von Plastiksprengstoff zu erzählen, ich höre eigentlich nicht mehr zu. Die Blätter wirbeln durch die Luft, und meine Gedanken folgen ihnen, sie taumeln hinterher, so völlig ziellos und zufallsbestimmt, braune, zerfressene Blätter, die nicht einmal anmutig sind.
Ich sehe uns jetzt von oben da sitzen, drei hagere Menschen, die Kleidung viel zu teuer, die Abstände zwischen ihnen so weit, wie es die Bank nur zulässt. Was ist nur aus uns geworden, will ich denken, bis ich bemerke, dass wir eigentlich nie anders waren. Und es wird mir ganz erschreckend klar, dass wir auch nie anders sein werden. Ganz egal, was wir auch tun, zwischen uns bleibt immer ein Trennstrich, wie nah wir uns auch kommen, unsere Haut bildet die Linie, die dafür sorgt, das wir nie wirklich eins miteinander werden können, nie verstehen können, was der andere da neben mir eigentlich meint, dass wir in unserem Kopf für immer allein gefangen sind. Und sogar mit mir selbst kann ich nicht identisch sein, ich kann gar nicht immer das Gleiche tun und denken und sagen und sogar zwischen meinen einzelnen Gedanken sind noch Räume und Unterschiede, die zusammenfließen und auseinanderreißen wie dickflüssiges Magma. Zwischen allen Dingen auf der Welt klaffen Spalten, die man gar nicht überwinden kann, die ich gar nicht überwinden kann. Es steht mir das alles so klar vor Augen, wie noch nie, ich zittere, das ist egal, ich weiß es jetzt, weiß jetzt, dass alles, was ich je getan habe, alles, was ich je versucht habe, nur dazu da war, diese Spalten aufzufüllen, weiß jetzt, wie falsch das war, weiß jetzt, was ich zu tun habe, nämlich die Spalten immer weiter aufreißen, bis alle Menschen darin verschwinden und am Ende alles in der Welt so unklar ist, wie in mir. Und dann erinnere ich mich wieder an meine Freunde, die hier neben mir sitzen, dass sie die einzigen Menschen sind, die ich kenne, die mich vielleicht ein wenig verstehen. Und dann denke ich daran, was jetzt das Unklarste und Unlogischste wäre, was die größte mögliche Differenz wäre zwischen dieser Tatsache und meinem Handeln, und dann ziehe ich mein Springmesser aus der Hosentasche und steche erst Gudrun ab und dann Andreas. Ich nehme überhaupt nicht wahr, wie Gudrun schreit und wimmert oder wie sich Andreas 300-Euro-Pullover langsam mit Blut vollsaugt, ich blicke nicht zurück, bis kein Licht mehr um mich ist. Dann bleibe ich stehen, atme eine Weile, ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes machen werde, aber irgendetwas wird sich schon ergeben.
ZWISCHEN RAUM
Ludwig Michael (18 Jahre), Mannheim – Lyrik