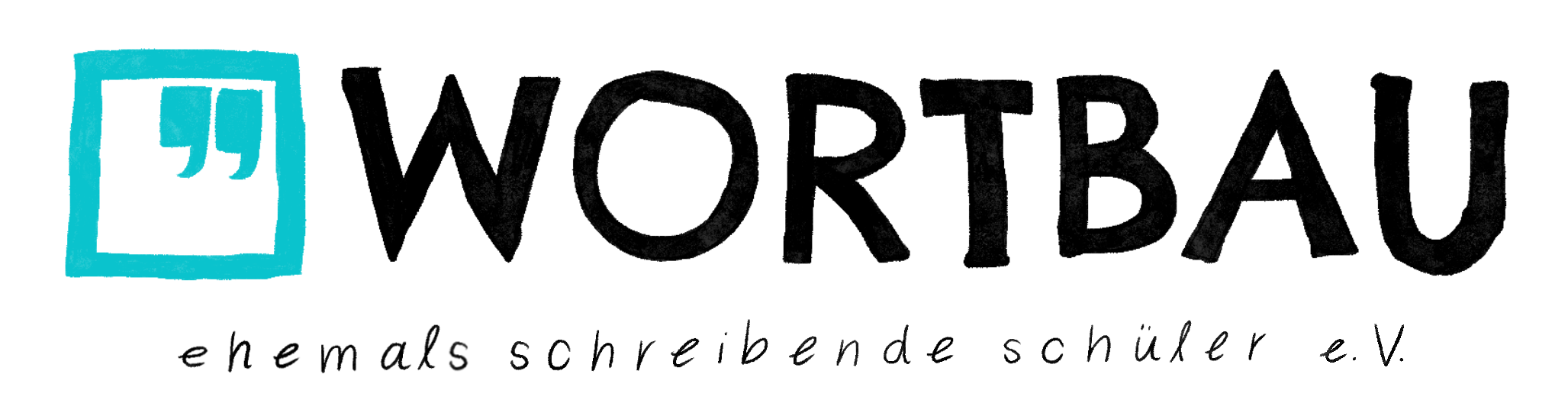Texte 2020
Wie der dreiäugige Wolf zu seinem Namen kam
Tilda Wolff (9 Jahre), Schwielowsee – Junior-THEO
Es war einmal ein Wolf mit drei Augen. Der Wolf war nicht besonders groß, genau genommen war er ziemlich klein. Er lebte aber auf einer sehr großen Insel. Diese Insel hatte drei Strände. Zwischen den drei Stränden stand ein sehr großer Palmenwald. In der Mitte des Palmenwaldes war eine Lichtung, die hauptsächlich aus Sand und vereinzelten Grasstellen bestand. Darauf befand sich ein sehr kleiner Baum. Der dreiäugige Wolf wohnte in diesem Baum. Der dreiäugige Wolf war Vegetarier und liebte Käse. Und am allerliebsten aß er Grillkäse. Im ersten Stock standen ein Grill und eine Truhe. In der Truhe befand sich Käse. Eine aus Holz geschnitzte Wendeltreppe führte in den zweiten Stock. Dort war ein Fell, auf dem er schlief.
Da der dreiäugige Wolf so klein war, wünschte er sich sehr, dass seine Insel auch ein wenig kleiner wäre.
Es war ein ganz normaler Morgen, als der dreiäugige Wolf aufwachte. Als er sich zum Frühstück Käse grillen wollte, hörte er ein lautes Geräusch. Der dreiäugige Wolf ging aus seinem Baum und schaute nach, was da los war.
Aber er sah nichts.
Doch wieso war da ein lautes Geräusch?
Der dreiäugige Wolf machte sich auf den Weg zum zweiten Strand. Weil der dreiäugige Wolf ziemlich klein war, dauerte es eine ganze Stunde. Als er beim Strand angekommen war, sah er ein großes Postschiff. Von dem Postschiff wurde eine Treppe ausgefahren und ein Mann stieg aus.
„Hallo“, sagte der Mann. „Ich heiße Michi und du?“
Der dreiäugige Wolf verstand den Mann zwar, aber er konnte nicht sprechen. Er hatte noch nie in seinem Leben mit jemandem gesprochen, weil auf seiner Insel noch nie jemand gewesen war, mit dem er reden konnte.
Michi fragte: „Hast du keinen Namen?“
Der Wolf nickte.
„Kannst du nicht sprechen?“, wollte Michi wissen. Der Wolf nickte wieder.
Michi gab ihm ein Paket und ging wieder auf das Postschiff.
Der dreiäugige Wolf brachte das Paket in seinen Baum.
F Ü R R A L L Y stand auf dem Paket. Der dreiäugige Wolf hatte keine Ahnung wer Rally war. Er machte sich auf den Weg, um heraus zu finden, wem das Paket gehörte.
Er baute sich ein Floß und packte seine Sachen und das Paket darauf.
Am nächsten Morgen ging er mit dem Floß zum Strand und ruderte los über das Meer. Nach ein paar Stunden sah er ein Land namens China. Der dreiäugige Wolf ruderte schnell an den Strand. Er ließ das Floß liegen und ging langsam in einen dichten Wald.
Als erstes traf er dort einen Jaguar. Den versuchte er mit Handzeichen zu fragen:
„Bist du Rally?“
„Nein, ich bin nicht Rally.“ Der Jaguar fragte ihn, ob er nicht sprechen könne. Der dreiäugige Wolf nickte.
„Möchtest du mein Freund sein?“, fragte der Jaguar. „Ich könnte dir bei der Suche nach Rally helfen.“
Der dreiäugige Wolf freute sich sehr und die beiden machten sich weiter auf die Suche nach Rally. Sie fragten noch viele, viele andere Tiere. Den Papagei, die Giraffe, den Elch und den Fuchs, aber niemand war Rally.
Die beiden überlegten, wen sie noch nicht gefragt hatten. Auf einmal fiel es ihnen ein.
Den Eisbären hatten sie noch nicht gefragt. Sie fuhren zu ihm, doch auch er hieß nicht Rally.
Aber der Eisbär wollte sich mit den beiden anfreunden und sie begleiten.
Dann machten sich alle drei mit dem Floß wieder auf den Weg zurück zu der Insel, wo der dreiäugige Wolf herkam.
Doch auf einmal entdeckten sie wieder Land. Sie fuhren zum Hafen und als sie vor dem Landestor waren, stand auf einem Schild WUNSCHFREILAND – das Land der Fragen und Wünsche. „Das ist ja perfekt“, sagte der dreiäugige Wolf, der inzwischen sprechen gelernt hatte. „In diesem Land finden wir bestimmt heraus, wer Rally ist.“
Als sie durch das Tor gingen, umgab sie eine warme Luft. Alles blühte. Weiter hinten war ein schöner, grüner Wald. Auf einer Lichtung machten Pinguine eine Grillparty mit ganz viel Grillkäse. Die drei Freunde aßen ein bisschen und gingen dann weiter durch das Wunschfreiland. Schließlich sahen sie einen Palast. Sie gingen zur Tür. Dort standen zwei Wachen. Die hatten grüne Pullover, eine rote kurze Hose und einen bunten Schal an. Auf dem Kopf trugen sie einen Blumenkranz. Die beiden Wachen fragten ganz freundlich: „Habt ihr einen Wunsch oder eine Frage?“
„Ja“, sagte der Jaguar.
„Alles klar“, sagten die Wachen. „Wir führen euch zum Meister, er weiß alles und kann Wünsche erfüllen.“
Beim Meister standen drei Sessel.
„Setzt euch“, sagte der Meister. „Habt ihr Fragen oder Wünsche?“
Der dreiäugige Wolf sagte: „Wir wollen wissen, wer Rally ist.“ Er zeigte dem Meister das Paket. Der Meister sagte: „Rally bist du!“
„Ich?“, fragte der dreiäugige Wolf.
„Ja du, du wurdest von deinen Eltern Rally genannt. Sie haben dich auf deiner Insel gelassen. Das ist bei dreiäugigen Wölfen normal“, sagte der Meister.
„Und was ist dein Wunsch?“
„Eine kleinere Insel“, antwortete der dreiäugige Wolf.
„Alles klar, wenn ihr ankommt, ist sie kleiner.“
Einen Tag später fuhren Rally der dreiäugige Wolf, der Jaguar und der Eisbär zur Insel. Nachdem sie dort angekommen waren, öffneten sie endlich das Paket.
In ihm befand sich eine Tulpenzwiebel.
Auf der Insel lebten sie mit ganz viel Grillkäse glücklich bis an ihr Ende.
Inselhaikus;
Meine Heimatinsel
Mira Elisabeth Bastrop (10 Jahre), Wittenförden OT Neu Wandrum – Junior-THEO (Lyrik)
Inselhaikus
1
Eine Insel liegt
in den Weiten des Meeres.
Punkt des Horizonts.
2
Das Geheimnis des
Ozeans liegt verborgen.
Du kannst es finden.
3
Insel dort im Meer,
du bist das Reich der Tiere
und der Sturmwellen.
4
Frage die Heimat,
die Insel des Ozeans,
der Sonnenschale.
Meine Heimatinsel
Vor der Insel im Meer,
dort komme ich her,
schwimmen Fischschwärme
in allertiefster Wärme.
Bei den hohen felsigen Klüften
schaukeln aus den Lüften
Vögel herab.
Oh, das hat geschwappt!
Dort der Seeadler,
sieh, wie er zu dem alten Fadler fliegt.
Was dieser Name zu bedeuten hat?
Das weiß nur das Watt.
Im Morgengrauen,
wenn die Fischer schauen,
frage es, was es zu sagen hat.
1
Irgendwo im Meer,
Nicht weit weg,
Seeadler fliegen umher.
Es schwimmen Fischschwärme,
Lichter leuchten.
Islandpferde galoppieren umher,
Mitten im Ozean.
Muscheln liegen im Sand.
Ein Weg ins Nirgendwo.
Eine kleine Landschaft.
Richte deinen Blick auf sie.
2
Das Ende des Ozeans,
Irgendwo unter dem Sonnenuntergang,
Eine eigene Welt.
Ist deine Heimat.
Niemals allein.
Sandweich, das Watt.
Es fallen die Sterne.
Langsam dunkelt der Himmel.
Insula
Luna Kröber (12 Jahre), Ingolstadt – Prosa (10-12)
Letschert sitze ich im Klassenzimmer und frage mich, warum ich überhaupt hier bin: Ich bin müde, ich bin verschnupft, ich will Ferien! Erfolglos unterdrücke ich einen Gähner und versuche, mich mit meinem Zauberwürfel wach zu halten, den ich ganz unauffällig unter der Bank verdrehe.
Meine Lateinlehrerin redet irgendwas von „arena“. Irgendjemand wird aufgerufen. Mist, dieser Jemand bin ich.
„Ähm, ähm.“ Mehr kommt von mir nicht.
„Sand!“, flüstert der lange Alex neben mir.
„Richtig Alex, aber ich habe Luna gefragt.“
„Aber ich hab‘s gewusst!“, kontert er und grinst frech.
„Luna, pass besser auf!“, meint Frau Sonderegger und fährt mit dem Stoff fort.
„Jaja“, nöle ich zur Antwort und wende mich voll und ganz meinem Zauberwürfel zu.
Wenn er doch nur wirklich zaubern könnte, denke ich mir, als gerade Angelina aufgefordert wird, das Wort „insula“ zu übersetzen.
Ha! Insel! Das hätte ich gewusst! Oh ja, eine Insel, das wäre schön, ich wünschte, ich wäre auf einer Insel, ganz weit weg. Nur ich und mein Zauberwürfel.
Plötzlich wird mein wunderliches Drehdings, das ich unablässig unter der Bank bewege, warm. Und noch wärmer. Und noch viel wärmer. Ich will das wilde Wirbeln in meinen Händen anhalten, stoppen, aber er dreht sich wie von selbst immer weiter! Was zur Hölle?
Doch auf einmal hält er an. Ich blicke auf einen Würfel, der nicht mehr blaue, grüne, weiße, orange und rote sondern nur noch gelbe Felder hat. Und er ist nicht mehr aus Plastik, sondern aus einem sonderbaren, krümeligen, Sandstein ähnlichen Material. Als ich versuche ihn zu drehen, fällt er auseinander und rieselt durch meine Finger auf den Boden. Sand? Oh Mist, das gibt Ärger! Ich sehe mich um, aber keiner hat etwas gemerkt, alle blicken nach vorne und folgen dem Unterricht.
Noch immer rieselt Sand aus meinen Händen auf den Boden. So groß war der Zauberwürfel doch gar nicht. Und wie kann das überhaupt sein? Meine Füße sind schon gänzlich von Sand bedeckt. So kann das doch nicht weitergehen!
So fest ich kann schüttle ich meine Hände, doch das war eine blöde Idee. Der Sand landet überall, und wo er landet, bilden sich immer größere Sandhaufen. Sie wachsen einfach von selbst, wie Zellen bei einem Tumor! Das hatten wir gerade in Bio! Von wegen, ich pass nicht auf!
Irgendwas stimmt hier nicht, halluziniere ich? Hier ist es plötzlich so warm, Schweiß tropft mir von der Stirn. Ich trinke jetzt erstmal was, vielleicht wird es dann besser.
Mit zitternder Hand greife ich nach meiner Flasche, die vor mir auf dem Tisch steht. Ich drehe den Deckel ab und versuche zu trinken. Doch die Flasche rutscht aus meinen schwitzigen Händen und kullert in den Sand, der schon den ganzen Klassenzimmerboden bedeckt. Das Wasser aus der Flasche bildet kleine Pfützen, die immer größer und größer werden. Bald schon schmiegt sich das Wasser um meine Füße. Krass!
Ich blicke mich zu Stella um und will sie fragen, ob sie auch sieht was hier vor sich geht, doch da ist keine Stella mehr. Hinter mir ist nur weiter Horizont, keine Klassenzimmerwand, nur Sand und Meer.
Schnell drehe ich mich wieder nach vorne, doch statt der Tafel sehe ich nun auch hier nur Sand und Meer, genauso wie links und rechts von mir. Auch Alex ist verschwunden, neben mir steht nun eine mächtige Palme mit riesigen grünen Palmwedeln und spendet mir Schatten. Ich sitze nicht mehr auf einem harten, pappigen Stuhl, sondern kuschle mich in eine gemütliche Strandliege. Ich kann mein Glück kaum fassen! Eine Insel nur für mich alleine!
Ich schließe meine Augen und genieße den Moment: es ist wohlig warm, Wasser streicht um meine Füße, Möwen kreischen irgendwo weit weg und fast wäre ich eingeschlafen, wenn nicht wie aus dem Nichts eine sanfte Stimme erklungen wäre.
„Guten Morgen!“
Ich öffne meine Augen und sehe eine Kellnerin, die mich sehr freundlich anlächelt und mir etwas entgegenreicht. OH, ein Cocktail! In einem bunten viereckigen Gefäß. Das ist aber nett!
„Dankeschön“, sage ich und nehme das Getränk an. Aber das ist ja gar kein Glas, sondern ein Würfel, ein Plastikwürfel. Mein Zauberwürfel? Blinzelnd blicke ich auf, und sehe in das Gesicht meiner Lehrerin, die mich erwartungsvoll ansieht.
„Ähm, Insel?“, rate ich ins Blaue hinein und setzte mich wieder gerade hin.
Frau Sonderegger nickt. „Richtig, Luna, und ich dachte schon, du hättest geträumt.“
Ende
Das Meer des Vergessens
Seraphina Mogk (11 Jahre), Kürten – Prosa (10-12)
„Alles fließt“, hatte Lara am Morgen im Lateinunterricht übersetzt. Wohin? hatte sich Lara beim Übersetzen gefragt. Jetzt wusste sie es. Sie war auf einem winzigen Boot, kaum größer als der Stuhl, auf dem sie saß. Das Boot wurde von eleganten Seepferdchen gezogen, die Lara geradewegs in das Meer des Vergessens brachten.
Links - oder sagt man auf einem Boot besser Backbord?– sah Lara die untergehende Insel des Lughnasadh, eines alten fast vergessenen, keltischen Feiertages. Zuvor hatte sie die winzige Insel des 13. Januars, des „Nationalen Räume-Deinen-Schreibtisch-auf-Tages“ passiert. Ein zurecht vergessener Feiertag, dachte Lara. Alles fließt…. in das Meer des Vergessens.
Einige Ereignisse stemmen sich gegen das Vergessen: Es sind Gedenktage, die Inseln bilden im unendlichen Meer des Vergessens. Es gibt hier Inseln zu Geburtstagen, zu Feiertagen und zu Gedenktagen. Die Insel für Weihnachten ist fast ein kleiner Kontinent, während die Insel zum Gedenktag des Weltpostverbandes kaum größer als eine Briefmarke ist. Lara war auf dem Weg zur Insel der verlorenen und vergessenen Socken.
Laras Familie hatte in der letzten Woche ihre Waschmaschine außer Betrieb gesetzt und eine neue angeschafft. Lara bewaffnete sich mit einem Akku-Schraubenzieher und wollte sehen, wie eine Waschmaschine funktioniert. Das fand sie nicht heraus. Dafür entdeckte sie jedoch in einem versteckten Hohlraum eine riesige Ansammlung einzelner, verstörter Socken. An einige dieser Socken konnte sie sich noch grob erinnern. Da war eine der pinken Prinzessinnen-Socken, die sie beim letzten Weihnachtswichteln von einem geschmackverirrten, aber netten Verehrer geschenkt bekommen hatte. Lara hatte sie nur ein einziges Mal angezogen, um nicht undankbar zu wirken. Da lagen aber auch viele Socken, an die sich nicht einmal mehr erinnern konnte. Fast erschrak Lara, als sie von einer rot-weiß-gestreiften FC Köln Socke ihres kleinen Bruders angesprochen wurde. Ihr Bruder war inzwischen ein Fan von Bayer-Leverkusen geworden. „Rette uns. Unsere letzte Zuflucht versinkt im Meer des Vergessens. Niemand gedenkt mehr der verlorenen Socken. Es gibt sogar Menschen, die nur gleiche Sockenpaare besitzen, weil sie es praktisch finden und so nicht einmal mehr merken, wenn eine Socke verloren geht oder ein Paar auseinandergerissen wird.“
Lara wurde sehr traurig über dieses Schicksaal der Socken. Vergessen zu werden war das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnte. Vor ein paar Jahren hatte sie mal ihr Opa auf dem Spielplatz vergessen. Aber das war nur für ein paar Stunden gewesen und die Polizei hatte sich um sie gekümmert. Aber diese Socken waren ganz in die Vergessenheit gesunken. Niemand vermisste sie und niemand kümmerte sich mehr um die einsamen Socken. Natürlich war Lara sofort bereit zu helfen. So begann ihre Reise. Sie folgte dem Fluss der Zeit und gelangte in das Meer des Vergessens.
Erst jetzt erkannte Lara, dass einige der Inseln bewohnt waren. Auf der Oster-Insel lebten niedliche Hasen zwischen bizarren Steinköpfen. Auf der fast vergessenen Insel Lughnasadh trieben grüne Kobolde ihr Unwesen und stritten sich über den immer knapper werdenden Platz. Schließlich stieß Laras Boot sachte an die Insel der Socken. Beim Verlassen des Bootes bekam sie nasse Füße, weswegen sie hier ein etwas schlechtes Gewissen bekam wegen ihrer nun durchnässten Socken. Wie würden ihre Socken sich jetzt wohl fühlen?
Auf der Insel lebten - wenig überraschend - haufenweise ungewaschene Socken. Alle wirkten etwas traurig (sofern Socken traurig wirken können), wahrscheinlich weil sie ihren Partner verloren hatten. Einige Socken hatten sich zu neuen Paaren zusammengetan. So sah Lara einen gelben Sneaker mit einem grauen Wanderstrumpf in zärtlicher Umarmung. Ein paar durchlöcherte Tennissocken in unterschiedlichen Größen brachten Lara zu dem Sockenpalast. Hier wurde sie von dem Socken-Kanzler empfangen.
Der Socken-Kanzler war eine alte, sehr würdevoll ergraute Wollsocke, die mehrfach geflickt worden war. Ihr Besitzer schien einmal sehr an dieser warmen Socke gehangen zu haben. „Wie kann ich euch helfen ?“, fragte Lara die Kanzler-Socke. „Du musst gegen das Vergessen kämpfen“, antwortete der Socken-Kanzler. „Die Menschen beachten uns zu wenig. Wir sind ihnen nicht wichtig genug. Daher vergessen sie uns schnell. Dadurch wird unsere Insel immer kleiner. Wir ertrinken im Meer des Vergessens!“
Bevor Lara fragen konnte, was sie denn dagegen tun könnte, war die Kanzler-Socke auch schon in eine der vielen Schubladen des Sockenpalastes verschwunden. Dafür war jetzt die pinke Prinzessinnen-Socke da und machte Lara große Vorwürfe, dass Lara nie mit ihr auf einem Ball war.
Danach wurde Lara zum großen Socken-Rat gebracht. In einem Halbkreis saßen mindestens 20.000 Socken von unterschiedlicher Herkunft. Es gab dunkle Herrensocken, elegante Damensocken, bunte englische Socken, Socken mit Punkten, Socken mit Streifen und Socken mit Karos. Lara entdeckte sogar eine Bart Simpson-Socke und eine Mona-Lisa-Socke.
Lara stand in der Mitte des Halbkreises und hielt dort als erste Nicht-Socke eine Rede, die in die Geschichte der Socken-Insel einging: „Liebe Socken, es ist sehr bedauerlich, dass niemand mehr an euch denkt. Aber statt zu jammern, solltet ihr die Menschen auf euch und eure Situation aufmerksam machen. Macht euch nützlich, dann wird man Euch auch nicht vergessen! Ihr könnt auch auf die Nikolaus-Insel auswandern. Dort werden viele einzelne Socken gebraucht“.
„Da lassen die uns aber nicht hin. Die wollen da nur rote Socken“, ertönte ein Zwischenruf.
„Dann versucht auf andere Art auf euch aufmerksam zu machen. Man kann tolle Stofftiere, Puppen und Steckenpferde aus Socken basteln. Auch das wäre eine Möglichkeit. Oder ihr könnt ein Leben als Lavendelsäckchen führen im Kampf gegen Motten. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Oder ihr könnt als Flaschenwärmer, Handy-Taschen oder Portemonnaie weiterleben.
Ich werde mit meinen Freunden und Freundinnen sprechen, dass sie sich besser um ihre Socken kümmern und anständig mit den zurückgebliebenen Singles umgehen sollen. Außerdem werden wir jedes Jahr am 9. Mai der verlorenen Socken gedenken.“
Es gab tosenden Applaus für Lara, wenigstens für Socken-Verhältnisse. Lara wurde nach Hause gebracht. Dort begann sie aus der FC Köln-Socke eine Handytasche zu basteln. Diese würde sie bei dem nächsten Weihnachtswichteln Noah schenken. Das war der Junge, der ihr die Prinzessinnen Socken geschenkt hatte.
Bergableuchtende Sterne, von einer Insel aus gesehen
Helene Vera Neubrandt (12 Jahre), Offenbach – Prosa (10-12)
Alles wirkt so unwirklich. Ich laufe durchs Parkhaus oder ist es eine Insel, nein Moment, ich bin doch zu Hause, da ist meine Couch und mein Bett. Wie kommen die hierher? Und wo kommen die vielen Spinnen her? Das Auto dort sieht so hologrammisch aus. Ob es weggeht, wenn ich es berühre? Tatsächlich, es verschwimmt. Oh Gott! Alles verschwimmt, alles löst sich auf. Was passiert hier? Es tut mir leid. Ich werde nie wieder ein Auto anfassen, bitte, bring das Parkhaus zurück. Aber wer soll es zurückbringen, die Landschaft fällt doch in ein dunkles Loch. Wie soll ich da wieder rauskommen. Ich glaube, ich muss mal mit den Schmetterlingen sprechen, sie sollen mir unbedingt mein Bett wieder bingen. Oh, ich habe bringen falsch buchstabiert. Ich muss ein R reintun. Nein, bleibt hier, Buchstaben, ihr schwebt immer noch falsch in der Luft! Aber die Buchstaben hören mal wieder nicht auf mich. Wer ist eigentlich dieses Ich? Bin das ich? Ist das Frank? Ist ich ich? Ich – schon wieder dieses seltsame Wort – weiß es nicht. Sowieso ist alles seltsam fern und warm. Nichts außer endlosem Himmel und ich, wer immer ich auch ist. Der Himmel, wir sind im Einklang. „Oh Zeit, wo bist du nur geblieben?“, rufe ich laut und anklagend. In diesem Moment wird der Himmel grün und ich sehe lauter Lebewesen, vor einer großen Uhr, deren Zeiger sich rasch nach vorne drehen. Die ganzen Menschen und Tiere, lebendig und jung, doch so schnell steigen sie hoch und fallen, lösen sich auf und es kommen neue. Eine Stimme erhebt sich und spricht laut: „Hier bin ich geblieben, im Hintergrund der Welt, alles Leben kontrollierend und unterdruckse-tzend, im Griff haltend.“ Es ist die Zeit, sie spricht zu mir. Ich werfe mich vor ihr auf die Knie, sie kontrolliert wirklich alles. Dann verschwinden die Bilder, die Uhr und die Menschen, und alles wird wieder dunkel und der Himmel ist wieder nur der Himmel. Aber die Sterne bewegen sich und leuchten immer mal wieder hell auf. Da ist ein Spiegel mitten im Himmel und ich erblicke mich darin, aber ein statisches Rauschen umgibt alles und ich sehe, dass ich eines im Gesicht habe. Es ist nervig und ich will es weghaben. Ich versuche es wegzukratzen, aber es geht nicht weg. Ach, da sind schon wieder die Schmetterlinge mit ihrem Sternenstaub. Irgendwie muss ich doch das Rauschen wegbekommen. Die Sterne leuchten immer noch auf und ab. In der Küche muss ich doch noch ein Messer haben. Das Rauschen schneide ich mir jetzt aus dem Gesicht. Eine klebrige, dunkle Masse fließt aus dem Rauschen. Sie sieht aus wie Kuchenteig. Das Rauschen ist aus meinem Gesicht, endloch. Ach, schon wieder falsch buchstabiert gesprochen, jetzt schnell, bevor die Buchstaben wieder wegfliegen, die haben einen interessanten gelben Schimmer. Ich ersetze schnell das o durch ein i und lass die Buchstaben ziehen oder heißt es Buschstaben? Egal. Ich sehe wieder in den Himmelsspiegel. Nein, das darf nicht sein! Das Rauschen ist wieder da, aber dieses Mal an meinen Beinen. Ich beginne wieder das Rauschen wegzuschneiden, da kommt auch wieder diese kuchenteigähnliche Masse, ob man sie essen kann? Ich probiere ein Stück davon. Nein, nicht lecker genug zum Essen. Schmeckt so metallisch süß. Das Rauschen geht nicht weg. Es verbreitet sich nur. Ich sehe unter der Kuchenteigmasse etwas Weißes, Hartes. Sieht aus wie ein Hähnchenknochen. Ich muss das Rauschen wegbekommen. Endlich, es ist von meinem Bein. Was ist das? Da ist ein helles Licht bei den Bäumen. Es singt den Ton Gelb und steht flackernd stumm, während es durch den Wald wandert, immer im Schatten der Bäume. Es ist ein Reh. Ein pulsierendes Gefühl unter meinen Zähnen, es atmet. Die Raupe unter meinem Zahnfleisch atmet, aber sie darf nicht leben und Eier legen. Nein, das darf sie nicht. Ich kriege sie dort weg! Ich schlage mir die untere Zahnreihe aus und manche der Splitter drücke ich tiefer ins Zahnfleisch, um die Raupe zu durchbohren. Widerliches Viech. Ich glaube, ich habe es vertrieben. Glücklich lasse ich mich in mein Kissen aus wohlwollendem Gras fallen, die Blätter pieksen kaum und alles ist gut. Die Sterne blinken immer noch bergauf und die Zeit steht im Hintergrund. Für eine Zeitlang ist alles verrückt, doch dann fängt das Pulsieren wieder an, wie ich es hasse. Es ist hinter meinem Auge. Es hat Eier gelegt, es muss Eier gelegt haben, sonst würde es nicht so käm-pfen. Es darf aber keine legen. Ich nehme mir den Stift auf meinem Schreiblisch und kümmere mich nicht darum, schon wieder falsch gesprochstabiert zu haben. Den Stift treibe ich durch mein Auge, um die Raupe zu durchbohren. Ich sehe auf dem einen Auge nichts mehr, aber ich spüre warme, glibbrige, Massen, die über mein Gesicht laufen und verstummen. Etwas fällt aus meinem Kopf in meinen Mund, es schmeckt rau und widerlich. Ich will es ausspucken, doch in dem Moment kriecht es von alleine heraus. Es ist die Raupe. Sie ist weg, endlich weg. Ich sinke zu Boden und kippe nach vorne, wodurch ich mir den Stift, der sich mittlerweile eher wie ein Dorn anfühlt, noch weiter in mein Gehirn treibe. Der Schmetterling holt mich, ich sehe ihn. Und dann – nichts mehr.
Lukas
Gesine Urban (15 Jahre), Petershagen – Prosa (13-15)
Kleckerburgen, Vertreter, Pizzazutaten, Pizza, eine Horde Menschenaffen, ein besonders großer Menschenaffe, ein Podiumsgerüst, die Schwester, der Inselwärter, Lukas der Lokomotivführer
Lukas der Lokomotivführer fährt an mir vorbei und weiter geradeaus ins Meer. Die Lok dreht sich wie ein toter Käfer auf den Rücken und treibt weiter raus.
Meine Schwester fragt, ob ich eine Pizza auf ihrem Rücken backen kann. „Mach ich“, sag ich. Eine Horde Menschenaffen überrennt die Pizzazutaten. Jetzt weint meine Schwester. Die Horde beginnt, Hotelhandtücher auszubreiten. Als sie fertig ist, jagt sie davon. Als die Pizza im Ofen ist, fällt uns eine sich bewegende Hotelkette auf. Sie wird nun von der Horde Menschenaffen durch den Sand gezogen. Ein besonders großer Affe sitzt oben und lenkt, indem er in regelmäßigen Abständen unterschiedliche Himmelsrichtungen in die Masse schreit. Immer mal wieder fällt der Eine oder Andere zur Seite weg und bleibt röchelnd liegen, wird aber sogleich durch einen der Außenstehenden ersetzt, die bereits aufmerksam das Geschehen verfolgen und auf einen freien Platz geiern. Wir sitzen jetzt da, mit zusammengekniffenen Augen und machen eine Wette draus, wer es wohl bis zu uns schafft.
Währenddessen auf der anderen Seite: Ein paar Einheimische beginnen riesige Kleckerburgen zu errichten. Der Inselwärter fährt mit einem kleinen Fahrrad durch den Sand, um die Bauwerke zu begutachten. Rechts und links am Fahrrad befinden sich jeweils zwei Stützräder, damit er überhaupt vorankommt. Bei jeder Kleckerburg legt er eine kleine Verschnaufpause ein, spricht den Leuten Mut zu und ringt sich ein Lächeln ab, bevor er wieder aufsteigt und weiterfährt. Sie singen das Lied von Lukas dem Lokomotivführer und wir summen leise mit.
Als die Pizza fertig ist, haben sich beide Gruppen bereits so nah aufeinander zubewegt, dass wir jetzt mitten im Geschehen sind und unseren Rückweg nicht mehr antreten können. Wir fragen Die hinter uns, wie sie sich entscheiden wollen und entfachen damit eine hitzige Diskussion, die jedoch zu keiner Entscheidung führt. Deprimiert flüchten sich ein Paar unserer Nachbarn in Richtung Meer. Vor uns errichten zwei Vertreter der beiden Gruppen bereits ein Podiumsgerüst. Als ihr Tun beendet ist, rennen auch sie in Richtung Meer. Inselwärter wie auch der riesige Affe erklimmen das Podiumsgerüst und nehmen oben Platz. Wir legen unsere Köpfe in den Nacken und schauen zu den beiden nach oben. Der riesige Affe trommelt sich auf die Brust und winkt einer Gruppe der verschwitzten Menschenaffen zu. Sie hängen die Hotelkette an einen Kran und fahren ihn zu uns herüber. Auf ein Zeichen des Affen wird eine Halterung gelöst und die Hotelkette fällt meiner Schwester um den Hals. Die Kleckerburgenbauer schreien auf. Der Inselwärter zieht eine Augenbraue hoch. Ich packe die Pizza ein, baue mir ein Boot und fahre davon.
In·sel·lö·sung
Johanna Weber (15 Jahre), Düsselsdorf – Prosa (13-15)
/Ínsellösung/
Substantiv, feminin [die] FACHSPRACHE
technisches System, das nur innerhalb seiner eigenen Grenzen wirksam und mit anderen Systemen der Umgebung nicht kompatibel ist.
- der DUDEN, Stand 2020-01-12
Ich muss mich abinseln, ausinseln.
Sonst treibe ich in der Gruppe
wie Fettaugen in der Suppe.
> Hühnersuppe, die meine Mama immer kocht, wenn es mir nicht gut geht.
„Damit du schnell wieder gesund wirst.“
[Ein Gespräch unter vier (Fett-)Augen.]
„Nein, für mich bitte keine Suppe, ich bin auf Diät.
Dieser Rettungsring verschwindet auch nicht von alleine!“
[höfliches Gelächter]
Dieser Rettungsring wird mich von der Gruppe wegtragen,
bis zu meiner Insel.
MEMO: Vielleicht lasse ich auch mal jemand anderen auf meine Insel,
der möglicherweise auch einen Rettungsring mitbringt.
(Alternativ wären auch Weihnachtssüßigkeiten erlaubt,
denn das sind bekanntlich die leckersten.)
Aber nur an den guten Tagen.
An den besseren Tagen bin ich beschäftigt.
Da möchte ich meine Haut umkrempeln,
an den Zipfeln fassen und umdrehen.
Und ich möchte meinen Kopf rasieren,
damit meine Haare keinen Schatten auf mein Gehirn werfen.
(Es wird schon so genug beschattet.)
„Cortana,
eine Gänsehaut zieht auf
Warum bekommt man eine Gänsehaut – Ursache und Bedeutung
und mein Nacken verspannt sich von der misslichen Lage.
Nackenverspannung lösen – 10 wirksame Tipps und Übungen
Ich will mich umdrehen, aber dafür tut mein Nacken zu weh.
Hilfe. Kann meinen Nacken kaum mehr bewegen ! Es tut so weh
Ich möchte mich inseln,
[Die auserwählten Oberschichtler der Gruppe verfassen den Duden]
Duden: sich inseln > 0 Ergebnisse
dabei gibt es das gar nicht.
Aber wenn niemand weiß, dass es das wohl gibt,
kann mich auch niemand dabei stören,
mich zu inseln.
[Königsblaue Tinte schwappt ans Ufer und über den Sand,
sie trägt eine leere Packung Zimtsterne mit sich.]
Die Gruppe ist mit dem Nachtisch fertig,
ich lecke die Krümel aus dem Plastik.
Ich fege den Strand zusammen
und puste den Feinstaub aus meinem Gehapparat.
MEMO: Ich habe ein paar Leuchtraketen,
aber die sind schlecht für die Umwelt.
Doch vielleicht ist das nur eine Ausrede,
weil,
vielleicht will ich in Wirklichkeit hier bleiben,
geinselt, mit meinem Rettungsring.
Duden Rettungsring: 6 Ergebnisse
> Rettungsring / Rettungsgerät / Schwimmgürtel / Rettungskörper / Hosenboje / dick sein
[Der Rettungsring hält die Luft an
und mir schmecken die Zimtkrümel nicht mehr.]
Das Wasser ist salzig,
Es ummantelt meine Haut in Regenbogenfarben
und mein verschlungenes Spiegelbild darin
wäre glücklicher ohne
a) die Gruppeb) den Rettungsringc) mich.
Inselpost
Johanna Liebe (15 Jahre), Neuruppin – Prosa (13-15)
Von Westen wehte ein kräftiger Wind. Das Meer bauschte sich fauchend vor den Klippen auf und brandete kreischend an die Steilküste. Wenn man die Augen zusammenkniff, konnte man jetzt am Horizont schon den Regen kommen sehen; große schwere Wolkenberge, die auf die Insel zurollten. Sarah krallte die Füße fester in den bröckligen Fels. Sie konnte das spröde Sommergras zwischen ihren nackten Zehen spüren, das einen angenehmen Gegensatz zum restlichen Geröll am Abhang bildete.
„Hast du es gefunden?“ Linns Stimme klang aufgeregt.
„Ich habe dir doch gesagt, dass es weiter nördlich wächst.“ Sarah warf noch einen Blick zum Horizont, dann musterte sie ihre zappelige kleine Schwester. Auch Linn war barfuß; sie hatte nur den alten Overall an, den sie bei der Muschelsuche trugen. Und Sarah war nicht sicher, ob sie es noch vor dem Regen zurückschaffen konnten. Vorsichtig rutschte Linn noch ein weiteres Stück Richtung Abhang, wobei ihr Gesicht vor Aufregung gerötet war. „Es wird doch nicht eingegangen sein, oder?“
Energisch packte Sarah ihren Stock und zog Linn am Ärmel wieder nach oben. „Komm jetzt. Sonst ist es Winter, ehe wir ankommen.“
Sie hatte die Stelle mit dem drahtigen Seegras vor zwei Wochen entdeckt, rein zufällig, als sie ein bisschen herumgestiegen war. Es war ein kühler, sonniger Freitag gewesen und die Lachmöwen, die sonst weiter unten am Hafen herumzankten, waren an diesem Tag bis zu den Klippen heraufgekommen, wo sie kreischend ihre Kreise flogen. Normalerweise gingen Sarah und Linn nur bis zu den Zwillingsfelsen, aber an diesem Freitag war Sarah allein gewesen und etwas ganz und gar Unerklärliches hatte sie zu den Spalten geführt, in denen sie das Seegras entdeckte; lang, fedrig und robust genug, um alles Mögliche daraus zu flechten. Es war ein wirklicher Glücksfund gewesen und sogar Mama hatte ein bisschen gelächelt, als Sarah ihr von ihrer Entdeckung erzählte. Heute aber war es grau; der Wind zerrte unnachgiebig an den Haaren der beiden Mädchen, während sie weiter kletterten. Das Meer hatte heute eine schwarze Farbe bekommen, stellte Sarah fest, eine unergründliche Tiefe, die an den Steilküsten der Insel leckte. Um das Plateau vor den Felsspalten zu erreichen, würden sie ein Stück am Abhang entlang klettern müssen. Vorsichtig tastete sich Sarah mit dem rechten Fuß voran, während sie den Stock mit der linken Hand umklammert hielt und immer wieder einen besorgten Blick zu ihrer kleinen Schwester warf.
Es war nicht so, dass das Klettern an diesem Hang besonders gefährlich gewesen wäre – nicht, wenn man sein halbes Leben auf der Insel verbracht hatte und selbst im Schlaf um sie herum klettern konnte. Wenn man sich gegen den Fels presste und festen Stein nicht mit bröckeligem verwechselte, konnte eigentlich nicht viel passieren, dennoch wurde Sarah das Gefühl nicht los, dass ihre heutige Unternehmung eine schlechte Idee gewesen war. „Halt dich weiter oben fest!“, schrie sie nach hinten.
Der Wind war noch stärker geworden und die Gischt der Wellen, die sich donnernd an den Klippen brachen, spritzte mehrere Meter hoch. Sarahs Zehen krallten sich tiefer in den spröden Stein, als sie sich weiter vorwärts schob. „Und nicht nach unten sehen, Linn, hörst du? Du darfst nicht nach unten sehen!“
Linn nickte, die Lippen konzentriert zusammengekniffen. Unter ihnen krachte erneut eine Woge gegen die Felswand, bäumte sich für einen Moment auf malerische Art auf und fiel schließlich in sich zusammen, während die Mädchen zum Plateau hinauf kletterten.
„Hier ist es!“, rief Linn begeistert, kaum, dass sie die bemooste Felsspalte erblickte. „Es ist wirklich hier, wie du´s gesagt hast! Oh, ich dreh durch!“ Ihre Wangen waren gerötet vor lauter Aufregung, als sie sich vor dem Gras auf die Knie sinken ließ. „Schau dir das an.“
Eilig warf Sarah ihre Tasche ab und krabbelte ebenfalls zur Felswand. „Es ist toll, nicht wahr?“
„Der Hammer“, bestätigte Linn ernst, während Sarah das Messer aus ihrer Hosentasche zog, um die Halme vorsichtig abzutrennen.
„Nehmen wir alles mit?“
Sarah schüttelte den Kopf. „Der alte Steven sagt, man muss immer etwas von den Pflanzen übrig lassen, damit sie neu wachsen können.“
Sie wollte Linn gerade erklären, was es mit dieser Weisheit auf sich hatte, als sie plötzlich etwas im Seegras entdeckte. Irgendetwas Buntes hatte sich in den Halmen verfangen; ein Fetzen Papier vielleicht, ein Zettel. Vorsichtig streckte Sarah die Hand aus und hob es auf.
„Was ist das?“ Linn warf einen neugierigen Blick über ihre Schulter.
Sarah starrte das Papier an. „Es ist eine Karte, glaube ich. Eine Postkarte.“
Ihr Mund war auf einmal seltsam trocken, sodass sie schlucken musste, um ihre Stimme wiederzufinden.
„Sie ist kaputt“, stellte Linn fest und deutete auf die linke untere Ecke, von der ein großes Stück fehlte. „Vielleicht hat eine Möwe sie zerrupft, weil sie sie für ihr Nest haben wollte.“
Sarah hob den Blick von der Karte und schaute sich um. Sie hatte begonnen, auf ihrer Lippe zu kauen, wie immer, wenn sie etwas beschäftigte. „Schon möglich. Das würde zumindest erklären, wie die Karte hier hergekommen ist.“
Die Mädchen musterten sie erneut. Das Wetter schien der Karte ziemlich zugesetzt zu haben, denn statt Buchstaben erkannte man nur noch verwaschene Tinte. Aber die Vorderseite war intakt, etwas zerknickt vielleicht, aber bestens zu erkennen.
„Es ist eine Stadt“, sagte Sarah an Linn gewandt. „Eine sehr, sehr große.“
Schweigend starrte sie das Bild an, das ein glänzendes Häusermeer unter azurblauem Himmel zeigte. Linns Augen waren weit aufgerissen, als sie ergeben flüsterte: „Es sieht riesig aus. Viel, viel riesiger als alle Städte, die ich kenne.“
Sarah nickte. „Es gibt solche Städte überall, weißt du. Überall auf der Welt. Und sie sind größer als alles hier zusammen!“
Linn riss den Mund auf wie ein Goldfisch und ruderte überwältigt mit den Armen. Ihre Augen leuchteten. „Warst du schon mal in so einer Stadt?“
Sarah starrte sie an. Der Wind hatte Linns blondes Haar völlig zerzaust, sodass es in alle Richtungen abstand. Dann schüttelte sie den Kopf. „Nein, Linn“, sagte sie und warf einen Blick auf die Regenwolken, die auf sie zuzogen. „Ich war immer nur hier. Genau wie du.“
Als sie später wieder hinauf kletterten, hatten die Wolken die Insel verhüllt wie ein riesiges, graues Tuch und die Luft war mit Feuchtigkeit vollgesogen, sodass man kaum noch etwas sehen konnte. Sarah bemühte sich, ihren Blick auf den Horizont zu richten. Sie hatte ihr Zeitgefühl verloren, und die Karte musste sie ziemlich lange aufgehalten haben. Linn schien überhaupt nicht zu bemerken, wie spät es geworden war. Zufrieden erklomm sie die letzten paar Felsen und krabbelte auf allen Vieren zur Ebene hinauf, um anschließend sofort das Seegras erneut zu untersuchen. „Meinst du, man kann einen Haarreif daraus machen?“
Sarah zuckte die Schultern. „Ich hab noch nichts ausprobiert.“
Wortlos zog sie ihre Schwester weiter. Sarah wurde immer unruhig, wenn sie nicht wusste, wie spät es war, aber heute war es etwas anderes. Sie hätte es nicht beschreiben können, aber irgendetwas hatte diese Postkarte in ihr ausgelöst. Traurigkeit? Wehmut? Fernweh? Sie wusste es nicht. Linn stiefelte schon in Richtung der Buckelfelsen, hinter denen die ersten Häuser des Ortes auftauchten.
Der Platz am Kai war fast menschenleer. Nur ein paar Fischer waren damit beschäftigt, die Boote zu vertäuen, bevor der Himmel seine Schleusen öffnete. Die Mädchen nickten ihnen nur im Vorbeigehen zu, während sie Richtung Uferstraße liefen, die Kapuzen ihrer Overalls tief in die Stirn gezogen.
Der kleine Ort zog sich eine Anhöhe hinauf; die Häuser duckten sich an den Abhang, fast so, als wollten sie einander vor den Stürmen schützen, die das ganze Jahr vom Meer aus über sie hinwegfegten. Tante Ida hatte einmal gesagt, dass an dieser Insel der Fortschritt der Zeit fast spurlos vorbeigegangen sei und jetzt, Jahre später, verstand Sarah, was sie damit gemeint hatte. Es gab viele Inseln hier im Umkreis; die größeren hatten eine Grundschule, ein paar Gaststätten und einen Supermarkt und einmal im Jahr kam eine handvoll Touristen, um Treibholz zu sammeln, Eis zu essen und im winzigen Ausstellungsraum des Rathauses ein paar lustlose Kreise zu drehen. Ihre Insel jedoch hatte außer einem Kiosk und der Post nichts zu bieten, und es kam äußerst selten vor, dass sich ein Fremder blicken ließ. Wer hier lebte, war entweder in der Schiffswerft zwei Inseln weiter angestellt oder verkaufte selbstgefangenen Fisch.
Vor ihnen in der Kurve konnte Sarah schon den Giebel ihres Hauses sehen, der sich hell gegen den schwarzen Himmel abhob. Ein schöner Anblick, dachte sie abwesend, während sie die Straße hinauf stapften. Ihre Gedanken konnten sich nicht von der Karte lösen, die in ihrer Jackentasche förmlich zu glühen schien. Wer mochte sie abgeschickt haben? An wen? Und welche Stadt war es, deren Foto auf der Vorderseite abgedruckt war? New York vielleicht, überlegte sie aufgeregt. Oder San Francisco.
Die Messer und Gabeln lagen falsch herum. Offenbar hatten Lissa und Ted Tischdienst gehabt. Sarah hängte ihren Overall auf die alte Heizung und ging in die Küche, um Tee zu kochen, während Linn mit dem Gras in der Hand die Treppe hinauf stürmte. Die heimelige Wärme des Hauses schien Sarah erst jetzt allmählich zu durchdringen, während sie Wasser aufsetzte und das Radio anschaltete. Von oben hörte sie Stimmen, Gemurmel von Tante Ida und staunende Ausrufe ihrer Cousine, als Linn ihr den Fund zeigte. Sarah nahm gerade das Geschirrhandtuch vom Haken, als Mama plötzlich hinter ihr auftauchte. Sie trug den gelben Bademantel und hatte ihre Haare locker im Nacken zusammengebunden.
„Ihr wart lange weg.“ Sie gab Sarah einen Kuss auf die Wange.
„Linn wollte das Seegras sehen“, sagte Sarah einsilbig und begann, eine Plastikschüssel abzutrocknen.
„Und habt ihr es gefunden?“ Sarah spürte, wie ihre Hände die Schüssel umklammerten. „Warum leben wir auf einer Insel, Ma?“
Die Worte waren heraus, ehe sie darüber nachdenken konnte. Sie drehte sich um. Das Geschirrhandtuch in ihren Händen war zu einem Knäuel verdreht. Mama stellte die Kaffeetasse auf den Tisch, und musterte Sarah mit gerunzelter Stirn.
„Ich…weiß nicht, Sarah…warum denn nicht? Ich meine, jeder Mensch wächst eben irgendwo auf und ich fand immer, dass es ein schöner Ort ist. Gut genug, um hier zu bleiben. Man braucht nicht immer die…“ Sie fuhr sich abwesend durch die Haare und ließ ihren Blick zum Fenster schweifen. „…die große weite Welt, von der alle träumen. Jeder findet seinen Platz mit der Zeit. Irgendwo; vielleicht in einer Stadt, vielleicht im Gebirge und vielleicht auf einer Insel.“ Sie blickte ihre Tochter an. Der Tee war fertig, aber Sarah rührte sich nicht.
„Wolltest du denn nie...weg?“
Ihre Mutter zögerte. „Weißt du, es kann auch ein Segen sein, wenn die Welt am Horizont aufhört. Manchmal ist das vielleicht genau das Richtige.“
Sie trat einen Schritt auf Sarah zu und zog sie in ihre Arme. „Es gibt nicht nur Inseln auf der Landkarte, Sarah. Es gibt auch Inseln, die wir uns selber erschaffen. Eine kleine Insel in unserem Kopf, auf der wir uns sicher fühlen.“
In dieser Nacht konnte Sarah nicht schlafen. Es war fast Vollmond und das milchige Licht fiel durch den Vorhangspalt ins Zimmer und ergoss sich über den Teppich. Im Haus war alles still. Linn, Ted und Lissa schliefen schon längst und atmeten friedlich; nur ab und zu ächzte das alte Haus unter der Last seiner Bewohner. Leise stand Sarah auf und tappte barfuß zur Fensterbank auf der anderen Seite des Zimmers. Sie schob den Vorhang beiseite und kroch dahinter, um die ganze Pracht der Sterne bewundern zu können. Als Großvater noch lebte, hatte er immer gesagt, dass die Gestirne des Himmels auf der ganzen Welt dieselben seien. Wo man auch steht, hatte er erklärt, ob in Japan oder Namibia- es ist immer genau derselbe Mond. Gedankenverloren fuhr Sarah das Sternbild des Großen Bären mit dem Finger auf der Fensterscheibe nach. Es war tatsächlich ein beruhigender Gedanke, überlegte sie, sich das vorzustellen: In der Stadt auf der Karte, die jetzt unter ihrem Kopfkissen lag, liefen jetzt vielleicht Leute herum, stiegen in Taxis und tranken Kaffee. Und anderswo in der Welt gingen vielleicht gerade Kinder zur Schule oder spielten im Urwald. Eine Insel im Kopf, hatte Mama gesagt. Sarah lehnte ihre Stirn gegen die kühle Scheibe und schloss lächelnd die Augen. Sie wollte eine Welt in ihrem Kopf haben. Eine große bunte Welt, mit abertausenden kleinen Inseln.
Außenaufnahmen aus Utopia
Tristan Ludwig (18 Jahre), Mannheim – Prosa (16-18)
Meine Creatio ex nihilo unterlege ich mit gedämpften Trapbeats als wäre ich Claas Relotius. Aus den Wogen meines Mare Nostrum erhebt sich vom Frühtau umfangen ein steiniges Riff, dessen scharfkantige Felsnasen vor dem magischen Licht der sich für die Sonne haltenden Bühnenbeleuchtung der Silhouette eines sakralen Gebäudes ähneln. Leicht durchbraust lauer Wind das stoppelige Ufergras, es scheint, als habe der moosgrüne Bewuchs der sich oberhalb der Steilklippe befindenden Plattform ob seiner eigenen Idylle eine geschwind anschwellende und gleich darauf wieder abflauende Gänsehaut. Es sitzen dort in einem Kreis elf freie und gleiche Bürger, sie verzehren nachlässig mit Tomaten-Basilikum-Aufstrich beschmierte Vollkornbrotscheiben und disputieren in erregtem Ton über die zu bezweifelnde Notwendigkeit einer Fährverbindung zum regnerischen Festland. Bei aller Heftigkeit der sachlich vorgetragenen Argumente beweisen die latent liebevollen Blicke, die sie einander zuwerfen, welch kämpferische Vergangenheit hinter und welch glänzende Zukunft vor ihnen liegt.
****
Mein Leben als Jugendbuchcharakter perpetuiert sich ins Lachhafte. Ich steche mir selbst ein Tattoo, nehme irgendwelche Drogen, male die Stromverteilerkästen meines Vororts an und schüttle meine ungelenken Gliedmaßen nächtelang zu elektronischer Musik. Bei Familienfeiern verschwinde ich auf der Toilette, um dort Schnupftabak von meinem Handrücken zu ziehen, denn Rauchen ist mir nicht erlaubt. In den Spiegel blickend wundere ich mich dann und wann, dass ich meine Dreidimensionalität noch nicht an das von mir repräsentierte Abbild einer Lebensweise verloren habe. Ungefähr einmal pro Woche treffe ich mich mit meinen Freunden um etwas kaputtzuschlagen. Den Anspruch, dabei etwas zu zerstören, das auch uns kaputt macht, haben wir schon seit längerem aufgegeben. Nicht einmal mehr besonders lebendig fühlen wir uns eigentlich in dem Moment, wenn eine Schaufensterscheibe splittert oder ein weiterer Familienwagen in den dicklichen Qualmwolken des im Innenraum verbrennenden Benzins sein Ende findet, doch ist uns recht deutlich bewusst, dass auch die destruktive Arbeit eine ist, die übernommen werden muss. Am Ende einer jeden solchen Nacht, nachdem wir uns unsere markenlosen, schwarzen Billigregenjacken in den kleinen Rucksäcken verstauend zerstreut haben, treffen wir uns wieder am Kiesstrand, draußen vor der Stadt. Aufgereiht sitzen wir dann da und schauen in die Ferne, wo sich bei klarem Wetter die scharfkantigen Felsnasen einer kleinen Insel erahnen lassen. Halbherzig reden wir vom schönen Leben, fast könnte man meinen, das Glänzen unserer Gesichter lasse sich auf echte Erregung zurückführen und nicht nur auf den Dauerregen.
****
In meinem Reich der kohärenten Erzählungen sind Sicherheit und Freiheit unter mal ab- und mal wieder anschwellenden Bocksgesängen stets gewährleistet. Innig verbunden umschlingen die sehnigen Körper von elf freien und gleichen Bürgern einander, jeder Wimpernschlag ist ein neuer fruchtbarer Moment. Sich in und übereinander wiegend zelebrieren sie die Heiligkeit ihres reinen Seins, von den Klippen hallen ihre Mantren mit kaum gekannter Erhabenheit auf und nieder. Bei aller Ekstase entgleitet ihnen nie das milde Lächeln der Sanftmütigen, nie schlägt ihre Bewegung auch nur für einen Moment ins Hektische um, alles ist Romantik, Idealismus, Heimatgefühl. Ein jeder ist sich seines Platzes in der zwanglosen Inszenierung bewusst, weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, über das tiefgreifende Wesen irgendeines Dings zu monologisieren und wann es gilt zu handeln, die Dinge ins Rollen zu bringen. Also erheben sie sich eifrig von ihrem liebestollen Spiel und wenden sich der Bestellung anderer, gleichsam wichtiger Aufgaben zu, einige schnitzen aus Eibenholz leichte Ferngläser, mittels derer sie das Festland beobachten können. Verschmitzt grinsend versichern sie sich, dass das, was sie dort sehen, sicher auch gar nicht so übel sei. Langsam verstreicht so der Tag, indem sich seine Konsistenz den Windböen anpasst, die in gleichmäßiger Abfolge über das Riff hinwegstreichen. Alles wird einander immer gleicher und verschwimmt in der Unklarheit einer allzu passenden Metapher.
****
Vereinzelte Regentropfen fallen auf das Dach des Opel Corsa. Matschiger Untergrund. Drinnen Migos aus dem Autoradio. Raindrop. Droptop. Alles quietscht und knarzt, wir lachen beinahe befreit. Zu schön ist der Ausblick auf die Küste, wo das trübe, vom Regen sich kräuselnde Meer auf die mit verfallenden Betonbunkern gespickten Steinstrände suppt. Die Straße führt bis vor ein kleines Haus, an dessen kaminroter Fassade das Meersalz deutliche Spuren hinterlassen hat. Wir lassen das Auto stehen, die Tür wird uns geöffnet, man begrüßt sich verhalten. Zu fünft scharen wir uns um einen Laptop, drängen uns so zusammen, dass jeder wenigstens einen ausschnitthaften Blick auf die amateurhafte Dokumentation über Straßenproteste im Süden erhaschen kann. Bei den zahlreichen Aufnahmen von brennenden Polizisten schnauben wir stets in der gleichen Tonlage anerkennend. Nach ungefähr einem dreiviertel des Films erstarrt das Bild, der W-Lan-Router ist offensichtlich wieder mal kaputt. Wir haben sowieso genug gesehen. Vor der Tür stehend rauchen wir schweigend filterlose Zigaretten, vor dem einsetzenden Sonnenuntergang zeichnen sich die Konturen einer felsigen Insel ab. Ich schnipse meinen Kippenstummel auf den Boden und beobachte, wie der Regen die letzte Glut zum Verlöschen bringt. Mir schreitet die Handlung nicht schnell genug voran. Alles hängt fest in seiner altbekannten Anordnung. Eilig umarme ich alle Umstehenden, bloß nicht zu endgültig, denn ein Ende soll es ja keinesfalls sein. Aus dem Kofferraum des Opels hole ich einen Neoprenanzug, den ich mir wie eine zu warm gewordenen Jacke über den rechten Arm lege. Ich winke noch einmal, hoffend, damit das letzte Mal der Logik meiner Figur entsprochen zu haben, dann gehe ich nicht einmal wirklich schnell los in Richtung der Küste.
****
Mit akribischen Skalpellschnitten trennen elf freie und gleiche Bürger die Lungenflügel des angespülten Körpers auf. Sanft streicheln sie ihm durchs gelockte Haar. In der Sonne glitzern die Edelstahlstrohhalme, mit denen sie den Teer aus seiner Lunge saugen, um ihn zu sich auf dem Boden türmenden klebrigen Batzen auszuhusten. Wenige, gezielte Schnitte braucht es nur, bis auch das Herz entfernt ist, sodass der Hohlraum unterhalb des Brustkorbs sich mit klarem Salzwasser ausspülen lässt. Durch einen weiteren Schnitt wird der Darm entnommen und fein säuberlich aufgerollt. Die Augenhöhlen darf ein besonders engagierter Bürger ausschlecken, man sieht ihm den Genuss deutlich an. Schließlich wird dem Körper das Blut aus den Adern gesaugt und dieses in einem gusseisernen Bottich gesammelt, den man unter Jubelschreien ins Meer kippt. Bis spät in die Abendstunden sitzen auf dem Felsriff die freien und gleichen Bürger zusammen und wärmen sich an einem brennenden Gegenstand, dessen Herkunft schon niemand mehr genau bestimmen kann. Während die Hintergrundmusik lauter und lauter wird warten sie sehnlich auf die Abblende, um ihre Feierlichkeiten endlich gemäßigter als je zuvor fortführen zu können.
Die Dienstagnachmittage
Emilie Sophie Vorhauser (17 Jahre), Meran – Prosa (16-18)
Sie schmeißt die Nudeln an die Decke und sie fallen mir auf den Kopf.
„Sind sie durch?“, fragt sie und ich habe ein Haar im Mund.
„Nein.“ Ich habe noch nicht gekostet. Sie wartet ja nie lang genug.
„Ich schmeiß sie weg, ich schmeiß sie weg“, sie schmeißt sie weg. Ins Klo und die Spülung klemmt. Im Bad flucht sie und in der Küche hör ich ihr zu, manchmal sagt sie was neues, dann schreib ich‘s auf den schweineblauen Post-it, und kleb ihn an den Kühlschrank. Meistens ist es ein Dienstagnachmittag auf der lila Insel. Einmal waren wir auf der gelben, aber das war zu schön um zu bleiben. Ich weiß nie auf welcher ihrer Inseln wir landen, sie fliegt immer rückwärts vor. Heut ist es schon ein Jahr an Dienstagnachmittagen und heute ist die Insel rot. Ich frag den Thymian, ob er sich an alle Inseln erinnern kann, der antwortet nicht, aber was weiß er schon von mir und den Inseln, Dreck und Wasser gibt’s überall. Was weiß ich denn schon vom Thymian. Was weiß ich denn schon. Ich hole den Tee aus dem Gefrierfach und stell ihn auf den Herd, Eisenkraut, weil die Hexen in den Märchen, die uns so ähnlich sind, es trinken würden. Sie ist meine Mutter und sie stellt den Tee zurück, und sie holt ihn wieder hervor und er schmilzt auf der Platte. Ich will den Tee im Glas trinken, sie glasiert damit den Kuchen. Niemand von uns hat den Kuchen gekauft, wer macht uns noch Geschenke, wer kennt uns noch.
„Denk doch bitte nicht, du bist so schön, bleib eingefaltet, mein Liebes, du bügelst immer Kreise in meine Nadelstreifen, und da find ich den Anfang nie.“ Sie klingt flüchtig beinahe wie sie sich anhört.
„Weil es keinen gibt“, sage ich. Vielleicht weiß sie, dass wir einen roten Dienstag haben.
„Du hast ihn nur verloren.“ Ich hab ihn nie gesucht. Ich hab ihn geschnitten. Ich hab den Kalender abgehängt. Die Zeitung neben dem Essen hab ich vergessen. All die Dienstagnachmittage und was, wenn heut der letzte ist, wird es nächste Woche einen geben? Gibt mir jemand bitte eine Hand, zum Halten, bevor meine erkalten. Der Nachmittag tagt nun schon seit mehr als siebenunddreißig dreiviertel Dritteln und sie schaltet das Radio ein. Im Rauschen hör ich den Pyotor und er weint, er meint, er kennt meine Schrift nicht, es tue ihm leid. Alles gut sage ich ihm, lieber Pyotor schreib deine Schwäne, alles gut, Mama wieso schaust du mich an, alles gut. In Gutmut ruht Wut. Sie ist meine Mutter, sie schreit über die Schwäne hinweg. Meine Mama weiß welche Insel wir malen.
„Mama, du bist so dumm wie ich, heut ist es nicht so weit, heut ist nur ein Tag, wie er vorgestern und übermorgen auch sein wird.“ Die Mutter hat schon die runtergefallene Zeitung aus dem Maul des Hundes gerissen und wirft sie mir auf den leeren Teller neben ihrem Essen. Sie war mal nicht so, und ich war mal froh. Aber das war vor einem Jahr auf dem Festland. Wenn heute voriges Jahr wäre, dann wär ich schon fast außerhalb, mit den Koffern voll und dem guten Studienplatz in der Stadt im Staub. Wenn morgen früher wäre, dann säße sie mit dem Rücken zu mir am Küchentisch, aber nicht an diesem, unserem, und im Spiegel würd sie mir die Zunge rausstrecken und ich würd sie ihrem Rücken zeigen, dann würden wir lachen und ich würde gehen. Wenn gestern später wäre, dann wär sie nicht so dämlich wahnsinnig geworden, bevor ich mir noch die Schuhe zubinden und die letzte Fähre nehmen konnte. Wenn jetzt, jetzt sein könnte, dann wär ich weg.
„Das ist nur der Sportteil, ich kann kein Mathe.“ Ich schiebe die Zeitung vom Teller.
„Sie holen mich ab.“ Das sollte mich freuen.
„Du bist doch kein Kind mehr, du musst schon allein dahin gehen.“ Kinder laufen allein zur Schule. Sie ist meine Mutter und seit einem Jahr meine Tochter. Sie steht zweifach neben mir und ich doppelt vor ihr. Wie viele Dienstagnachmittage haben wir als Mutter Tochter auf Inseln verbracht, wie viel davon als gestört und entgleist. Ich koche uns Nudeln. Sie isst ihre nicht. Ich roll die Spaghetti auf meine Gabel und ich füttere sie, sie kleckert, ich bin so müde. Es ist doch erst Nachmittag. An der Tür klopft es.
„Klopf zurück.“ Sie haut mit der Hand auf den Tisch, die Hand schwillt rot.
„Wer will uns?“ Ich frag die Tür.
„Wir nicht.“ Das sagt die Tür, dann geht sie auf.
„Guten Nachmittag.“ Ich streck die Hand zum Gruß, der erste Herr schiebt sie sanft zurück, der zweite schlägt sie weg. Den dritten sehe ich nicht.
„Es ist Abend“, sagt der dritte von irgendwoher.
„Für sie“, sage ich von daneben und sperre die Küche mit dem Holzblock ab, meine Mutter sitzt hinter der Zeitung. Die unbestimmte Anzahl an Herren sehen die Nudeln im Klo und bieten mir neue an, aber ich habe schon gegessen, danke. Ja heute viel, ich war hungrig, ja morgen leicht, ich bin ja dick. Die Herrschaften wollen Kaffee.
„Wir wollen Tee.“
„Den hab ich nur kalt.“ Ich hab nur Kaffee.
„Dann warten wir, bis er wieder warm wird.“ Die dutzend Herren stehen in meiner Küche und meine Mutter sitzt am Tisch. Der siebente küsst meiner Mutter die Hand, die sie mir schon zuhält.
„Das ist ihre Mutter“, der dreizehnte zeigt neben sie und hinter mich, wir beide nicken. Sie ist es wohl. Ihre Hand entgleitet mir, ich heb sie nicht auf. Sie sind in der Küche meiner Mutter, die meine ist, und es ist mir alles egal, weil alles gut ist.
„Wir holen sie jetzt ab.“ Nummer Vier holt sie mir, Nummer Acht hat sie weggebracht. In der Scheibe streckt sie mir die Zunge raus, meine sieht sie nicht mehr.
Heute ist ein blauer Donnerstagmorgen und der Horizont ist ein Berg.
Auf einer Insel fliegen
Torben Schilling (17 Jahre), Berlin – Prosa (16-18)
Dina saß, das Kinn auf die Knie gestützt, in ihrem Kinderzimmer und guckte sich ein Bilderbuch an. Auf dem oberen Teil der Seite standen fünf Buchstaben: V-Ö-G-E-L.
Sie konnte zwar noch gar nicht lesen, doch ihr Vater hatte es ihr einmal vorgelesen und sie hatte sich das Wort gemerkt. Stolz blickte sie der Reihe nach die bunten Bilder an, die darunter lagen. Bei jedem Bild sagte sie laut den Namen des darauf abgebildeten Vogels: „Papagei, Specht, Pelikan, Flamingo, Kakadu-“
Plötzlich wurde ihr langweilig.
Sie stand auf, griff nach einem Ende ihrer Kuscheldecke und schlurfte aus dem Zimmer. Die Decke hinter sich herziehend, ging sie durch den Flur ins Wohnzimmer und machte vor einer über dem Sofa schwebenden Zeitung halt. Dann fragte sie: „Mama, wo ist Papa?“
Die Zeitung wurde links und rechts von einer Hand festgehalten und unterhalb von ihr guckten zwei übereinander geschlagene Beine hervor.
„Er ist auf einer Insel“, ertönte eine genervte Stimme von jenseits der Zeitung.
„Ah achso“, sagte Dina und senkte verlegen den Blick. Sie begann nachzudenken.
Was war eine Insel? Ihre Mutter hatte sich so angehört, als wäre alles gesagt. Dina hatte aber noch nie dieses Wort gehört. Das Einzige, was sich halbwegs ähnlich anhörte, war Amsel. Eines der vielen Vögel aus ihrem Bilderbuch. Wahrscheinlich war eine Insel so etwas Ähnliches. Sie musste aber deutlich größer sein, wenn ihr Vater dort drauf sein konnte. Sie stellte sich vor, wie er sich nach vorne gebeugt in das schwarze Gefieder der Insel krallte und mit ihr schnell durch die Luft flog. Sie würde auch gerne fliegen können. Es würde bestimmt Spaß machen.
Sie richtete sich wieder auf und starrte einen Moment lang auf die Zeitung. Da waren Buchstaben, doch sie konnte sie nicht lesen. Dort stand nicht „Vögel“.
„Wo fliegt er denn hin?“, fragte sie.
„Nach Hawaii“, kam die Antwort.
„Ist das weit weg?“
„Sehr weit weg.“
Dina begann wieder zu überlegen. Ein kurzer Flug wäre sicher erfrischend und spaßig. Auf Dauer würde es aber bestimmt langweilig werden. Außerdem würde man sicher sehr hoch fliegen und weit oben war doch immer sehr viel Wind. Man müsste sich fest an den Hals der Insel klammern, um nicht herunter zu fallen. Das wäre nicht angenehm.
„Ich hoffe er holt sich keine Erkältung“, sagte sie nachdenklich.
Die Zeitung bewegte sich rascheln nach unten und das genervte und verständnislose Gesicht ihrer Mutter kam zum Vorschein.
„Was? Auf Hawaii?“
Wer Papierschiffchen ins Wasser setzt, muss sich nicht wundern, wenn sie sinken
Ronja Lobner (17 Jahre), Petershagen – Lyrik
plastikfreie inseln
Theresa Bolte (18 Jahre), Eberswalde – Lyrik
Karls Leichnam, auf einem gebogenen Ast Richtung Süden
Ruta Dreyer (17 Jahre), Hannover – Lyrik
wir sind an diesem Tag dem Fluss gefolgt dem
strömenden Gewitter aus Kälte und Kotze
in braunen Flecken konnten wir sie erahnen (die
Mutmaßung jemand zu sein)
und die Stirn fanden wir auch die Stirn die
i r g e n d j e m a n d
uns und um dem Fluss bieten wollte immer wieder
die tollkühnen Selbstversuche einer kalten
Zeit aber es sind ja nur Phasen
zwischen den Sträuchern strampelten
Enten an den Ufern kalkulierten die
Wellen ihren Schaden falsch ein
La lluvia, la lluvia
Selin Eslek (16 Jahre), Mönchweiler – SprachRäume / Aus dem Spanischen übersetzt von Odile Kennel
Esta mañana, cuando Sr. B se levantó, se puso sus pantuflas rosas y entró en el baño.
Al mirarse en el espejo, observó, que una flor le había salido de la cabeza. Había notado la pérdida de cabello empezando en la mitad de su cabeza, pero lo había interpretado como un signo de edad. Ahora tenía que llegar a la conclusión de que debía ser la flor la que usaba su piel calva como isla en el mar de pelo para ganar libertad. Para echarla una mano, el cabello tuvo que caerse y comenzar sus propios viajes. Sr. B decidió dejar que la flor crecera y de ahora an adelante sólo tener pensamientos hermosas para que los raíces pudieran tomarles y hacerse más fuertos y las hojas más espléndidas.
Der Regen, der Regen
Als Herr B an jenem Morgen aufstand, schlüpfte er in seine rosa Pantoffeln und ging ins Bad. Er sah in den Spiegel und stellte fest, dass ihm eine Blume aus dem Kopf gewachsen war. Er hatte schon bemerkt, dass ihm die Haare im Zentrum seines Kopfs ausfielen, aber er hatte es auf sein Alter geschoben. Nun kam er zu dem Schluss, dass es wohl diese Blume war, die die kahle Haut mitten auf seinem Kopf als Insel im Meer der Haare nutzte, um sich frei zu wachsen. Um ihr behilflich zu sein, musste das Haar ausfallen und seine eigenen Wege gehen. Herr B beschloss, die Blume wachsen zu lassen und von nun an nur noch schöne Gedanken zu haben, dann könnten die Wurzeln sie aufnehmen und kräftiger werden und die Blätter prächtiger.
Ich
Michael Gavrilov (15 Jahre), Berlin – SprachRäume (Einsendung als DaZ)
Keine Seele, die mich sieht
Kein Atem, der mich weiterträgt
Niemand ist da, außer sieben Sachen
Die ich versuche als Freund zu machen
Meine Gedanken sind gleich in Flammen,
Aber kein Blatt, um etwas zu sagen
Ohne Licht ist auch kein Schatten
Das heißt, ich bin nicht frei, bisher
Grundlos trinke ich
Sinnlos beschreibe ich mich
Finde keinen Ausgang
Aber dafür ein besseres Fenster
Ostatnia wyspa
Kaja Schwede (13 Jahre), Hamburg – SprachRäume / aus dem Polnischen übersetzt von Anna Hetzer
Kiedy się w tym świecie tyle zmienia
ja tutaj siedzę, już nic nie mamy do powiedzenia
w tej chwili i za sto lat
to nie nasza zasługa ten świat.
Bo skoro my jesteśmy najgrożniejszą rasą,
wtedy decyzja nie jest osoby własną.
U nas zawsze licziła się wielkość
a nie dzielność.
To nie jest wspierające dla rebeliantków
ale inni zobaczą znów…
Jak jeszcze tylko jedna wyspa zdrowa zostanie nam:
Myśmy próbowali utrzymać dłużej życzie, podczas reżimu u was,
w tym przypadku nie raz,
i teraz pytacie nas,
czy możecie wstąpić na tą wyspę,
czy możemy pomóc wam?
Problem polega na tym, że my nic nie mieliśmy do powiedzenia
a takie coś to się nigdy nie zmienia!
życzie,
nie życzie.
Letzte Insel
Während sich so viel auf der Welt ändert
sitze ich hier, wir haben nichts mehr zu sagen
in diesem Moment und in hundert Jahren
die Welt geht nicht auf unser Konto.
Denn wenn wir die gefährlichste Spezies sind,
drehn sich Entscheidungen nicht um uns selbst.
Es zählte immer Größe
nicht Mut.
Das hilft keiner Rebellin
aber die anderen werden schon sehen...
Wenn uns nur eine gesunde Insel bleibt:
Wir haben versucht, länger zu leben, bei euch im Regime
nicht nur einmal,
und jetzt fragt ihr uns,
ob ihr auf dieser Insel willkommen seid
ob wir euch helfen können?
Das Problem ist, wir hatten nichts zu sagen
und das ändert sich nie!
Leben,
nicht leben.